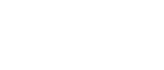Eigentlich sollte es ein normales Abschlusssemester werden, ein paar letzte Kurse, das Pflicht-Praktikum und die Bachelorarbeit. Doch von dieser „Normalität“ ist Sabine Krauß dieser Tage weitentfernt. Statt im Hörsaal oder der Bibliothek zu sitzen, statt im Labor zu stehen, studiert die 23-jährige Ökotrophologie-Studentin meistens in ihrer kleinen Hamburger Wohnung. Tag für Tag am Laptop, Seminare und Vorlesungen am Schreibtisch. Nach neun Monaten Studium im Corona-Modus hat sich eine gewisse Routine eingestellt. „Ich habe mir feste Zeiten für die Seminaraufgaben geschaffen und einen eigenen Stundenplan zusammengestellt. Außerdem habe ich dieses Semester einige Video-Vorlesungen, in denen man sich aktiv beteiligen kann“, berichtet sie.
Auch der Ausgleich zum Studium gelinge ihr immer besser. Im März und April sah das noch ganz anders aus. Überrascht vom Lockdown und kaum auf komplett digitale Lehre vorbereitet, reagierten viele Dozent*innen mit einem Mehr an Aufgaben. Unter hohem Druck mussten sie Lösungen finden und die Lehre komplett auf Online umstellen: Power-Point Präsentationen statt Referate, Hausarbeiten statt Prüfungen, viele Hausaufgaben in der Hoffnung, den eigenen Studierenden etwas mehr Struktur im Alltag zu geben. Als sehr stressig und belastend bezeichnet Krauß die Zeit des ersten Lockdowns. „Wir mussten uns mit der neuen Studiensituation arrangieren, dazu kam die große Ungewissheit, wie und wann es normal weitergeht.“
Die Pandemie nagt an der Psyche
So wie ihr ging und geht es vielen Studierenden in der Corona-Pandemie. Der Virus und seine Auswirkungen sind im Alltag omnipräsent. Der Tag beginnt mit neuen, erschreckenden Meldungen zu steigenden Infektionszahlen und überfüllten Intensivstationen. Soziale Kontakte sind auf ein Minimum beschränkt, die meisten Kommilitonen sieht man nur im Video-Chat. Viele sorgen sich um Angehörige und Freunde, die selbst zur Gruppe der Risikopatienten zählen. Dazu kommt die Unsicherheit über die berufliche Zukunft – kann ich einen Master in einer anderen Stadt beginnen, bekomme ich einen Platz für mein Fachpraktikum, wie soll der Berufseinstieg in der Krise gelingen?
Studien zeigen, dass Ängstlichkeit, Hoffnungslosigkeit und Depressivität seit der Pandemie zugenommen haben – nicht nur, aber auch bei Studierenden. Laut einer Befragung der ETH Zürich sind dabei besonders Studierende gefährdet, die alleine wohnen oder sich in der neuen, großen Stadt noch kein soziales Netzwerk schaffen konnten. Frauen leiden unter Kontaktbeschränkungen stärker als Männer. Ein einfacher Grund: Sie haben oftmals einen größeren Freundeskreis und treffen sich häufiger mit ihren Freund*innen. Umso belastender ist für sie ein Herunterfahren des sozialen Lebens. Ein großes Dilemma dieser Pandemie: Normalerweise sind genau diese sozialen Kontakte, das Zusammensein mit den Freunden, die Umarmung der besten Freundin, ein guter Weg, die eigene psychische Krise zu lindern und schwere Gedanken aufzufangen.
Die Struktur des Alltags bricht weg
Dass die Corona-Pandemie an unseren psychischen Grundbedürfnissen kratzt, beobachtet auch Alla Bogdanski seit Anfang März. Die Psychologin und Verhaltenstherapeutin ist psychologische Beraterin in der Studienberatung der HAW Hamburg. „Der größte Einschnitt für Studierende ist der Wegfall der Struktur und Sicherheit. Das trifft vor allem die Studienanfänger*innen“, sagt sie. Frisch von zu Hause ausgezogen, würden ihnen noch die sozialen Kontakte in der fremden Stadt fehlen, auch die Selbstorganisation falle ihnen oft schwer. Normalerweise gibt ihnen die Hochschule die Struktur des Tages vor – durch Vorlesungen und Seminare, durch Lerngruppen und durch Angebote wie Sport, Sprachtandems oder die Arbeit im Fachschaftsrat.